
70m-Rotormast, 4x5-Elemente wide-spaced-Beam (13,2m-Boom) von VK3MO*
mit 100 Watt ein Super-Signal auf 20m in DL
Die von mir gewählte Gliederung sieht so aus:
Was ist DXDX-Praxis
-allgemeines
Jeder DXer wird sein Hobby anders definieren. Für den einen sind
lange Funkgespräche interessant und wichtig. Andere wollen ihre Fremdsprachenkenntnisse
erproben und ausbauen. Wieder anderen genügt ein schneller Rapportaustausch. Die Funkstation eines eingefleischten DXers
ist auf das DXen zugeschnitten. Das muß nicht die Endstufe beinhalten, die sich auf
750 Watt runter regeln läßt. Ein 3-Element-Beam
ist natürlich toll. Ein typischer
3-Element-Dreibandbeam bringt es aber immerhin auf eine Tragrohrlänge von 5m, eine maximale
Elementlänge von 7,57m und einen Drehradius von 4,65m bei 17kg Gewicht
(hofi * Fritzel
FB33). Nicht jeder darf ein solches Gebilde aufs Dach setzen. Entweder hat die
XYL was dagegen, oder der Vermieter, die lieben
Nachbarn oder das Bauordnungsamt (eine 65m-Leiter in Duisburg oder 50m-Stäbe als Gesamtkunstwerk "Standortmitte" in Köln und Bonn sind aber durchaus als Kunstwerke
genehmigungsfähig). Der eigene Geldbeutel setzt den Träumen gewisse Grenzen.
Deshalb wird ein EME-Sked selten auf 160m verabredet. Ein Funkamateur ohne
Antenne ist ein armer Wicht. Da bleibt nur noch Basteln, ARDF oder SWL. Je größer und je höher die Antenne (in Bezug auf die
verwendete Wellenlänge
), um so einfacher fällt das DXen.
Zur Einstimung ein paar Bilder von großen Amateurfunkantennen. Die sind zwar eher die Ausnahme, aber durchaus anzutreffen:







Nebenbei, so sehen große UKW-Antennen aus:

Auf Kurzwelle hatte mal ein Amerikaner einen Dipolwand drehbar auf Eisenbahnschienen aufgebaut. Ein Russe hat mir auf seiner QSL-Karte seine gestockte Rhombusantenne aufgezeichnet. Das Motto mancher Antennenbauer: Wenn die Antenne den letzten Winter überstanden hat war sie nicht groß genug! Wer sich noch an den Woodpecker * der Russen erinnert: die Antenne war 150m hoch und 1000m lang. Da werden dann doch noch Unterschiede zu den Kommerziellen oder Miltärs deutlich.
Übrigens ist nicht die Antenne mit dem größten Gewinn die beste DX-Antenne, sondern die Antenne, mit der ich bei der DX-Station am lautesten ankomme. Die Aussage wird verständlich, wenn man die unterschiedliche Sprungzahl infolge unterschiedlicher Abstrahlwinkel anschaut und dies beim Streckenvergleich mit berücksichtigt. Die Sprungweite beträgt zwischen 1000 und 3000 Kilometer. Jede Reflexion an der Ionosphäre und am Boden ist verlustbehaftet (ca. 0,1db). Da schmilzt der Gewinn einer steil strahlenden Antenne gegenüber einer Antenne mit weniger Gewinn und flacher Abstrahlung schnell dahin. Antennen mit Super-Gewinn haben zudem einen sehr schmalen horizontalen Öffnungswinkel und es ist schwierig, sie genau auf die Gegenstation zu richten.
Wie es auch ein paar Nummern kleiner geht hat unser OV-Mitglied Wulf, DL1DEV am 6. Februar 2002 in seinem Vortrag Urlaubs- und Notfunkkoffer gezeigt.
Aber die Stationsausrüstung ist nur eine Seite der Medaille. Mindestens genau so wichtig sind die funkerischen Fähigkeiten: hören - hören - hören. (Nicht alles was man so hört stellt gute Betriebspraxis dar!) Bei interessanten Gesprächen ich auch gerne einfach mal zu.
So habe ich mal einen Antennentest mitbekommen. Ein Amerikaner mit 3 Antennen übereinander hat getestet. Dabei kam heraus, daß die mittlere und obere Antenne zusammen schon so gut waren wie mit der unteren Antenne zusammen.
Bei einem anderen Test zwischen Südamerika und Schweden hat sich gezeigt, daß ein QSO mit 100 Watt auch noch mit 10 Watt (und 1 Watt?) aufrecht erhalten werden konnte.
Fasziniert war ich auch von einem rag-chew zwischen zwei offensichtlich älteren OMs: Spürst du auch schon, daß du älter wirst? Hm, ja. Früher konnte ich den 60m-Mast in einem Zug hoch klettern, heute muß ich in der Mitte verschnaufen. Es ging auch noch um Schwerlastkräne (800t? Naja, da fängt das Spiel an) und um die Bergung des sowjetischen Atom-U-Bootes KURSK.
Im Pile-Up mit einem Deutschen in Liberia habe ich mal ganz unmotiviert außer 59 noch Grüße aus Duisburg bestellt. Ich wurde ganz aufgeregt aufgefordert zu warten. Ob ich wohl telefonische Grüße an die Eltern in Duisburg bestellen kann? An der Telefonnummer erkannte ich, daß die Eltern in Beeck wohnen. Die Herzogstraße war nur 2 Querstraßen entfernt. Statt eines Telefonats habe ich die Eltern sofort aufgesucht. Die Pantoffel flogen, "Vater, den Wagen!". Minuten später waren die Eltern mit mir an der Station. Ein tolles Weihnachtsgeschenk für alle Beteiligten.
Geduld und Ham-Spirit sind also gefragt. Wenn es mal nicht sofort klappt, die nächste QSB-Phase abwarten, in der die Gegenstation laut wird. Das ist der richtige Zeitpunkt, selbst zu rufen. Und wenn der Skip mal wirklich nicht hinhaut, dann warte ich auf den nächsten Tag. Da ein Hobby Freude bereiten soll, sollte man die Ansprüche gegebenenfalls etwas runter schrauben. Aus der Stadt heraus wird man mit einem relativ kurzen Draht und einem Antennenanpaßgerät kaum auf 160m ein "full house" (alle 338 DXCC * -Gebiete) schaffen. Unter eingeschränkten Bedingungen sind da 100 DXCCs schon eine tolle Leistung. Also realistische Ziele setzen und sich über die Erfolge freuen. Dabei ist es ratsam, mit dem Sonnenfleckenzyklus zu arbeiten. Also im Sonnenfleckenminimum die langen Bänder und im Sonnenfleckenmaximum das 10m-Band abgrasen. Nach einem QSO mit einem seltenen DX mache ich QRT (natürlich nicht während eines Contestes mit der Chance auf mehr DX). Besser kann der Tag nicht werden!
Mit einem Vertikaldipol habe ich erreicht:
214 bestätigte DXCC-Länder SSB,
111 bestätigte DXCC-Länder 40m SSB
Tabelle
QSLs
DL-DX-Diplom
Peter, DJØGD aus Moers hat mit einer einfachen Groundplane-Antenne und mit QRP 278 DXCCs bestätigt.
Das als Ermutigung, DX auch mit einer kleinen Station anzugehen. Mehr als 338 DXCCs gibt es auch
mit der größten Antenne nicht zu arbeiten. Der Aufwand für den immer einfacheren
Erfolg auf Grund der Stationsaufrüstung beim DXen steigt überproportional.
Wer genaue Informationen zu den Prefixen sucht und zur Rufzeichenverteilung innerhalb der Länder, der sollte bei AC6V (sk) nachsehen. Dort wird man feststellen, daß eine Ø im Rufzeichen nicht unbedingt eine Clubstation kennzeichnet (der Ausdruck liegt bei mir neben der Station).
Stellvertretend für viele ähnliche Programme möchte ich hier DX Atlas * von VE3NEA vorstellen
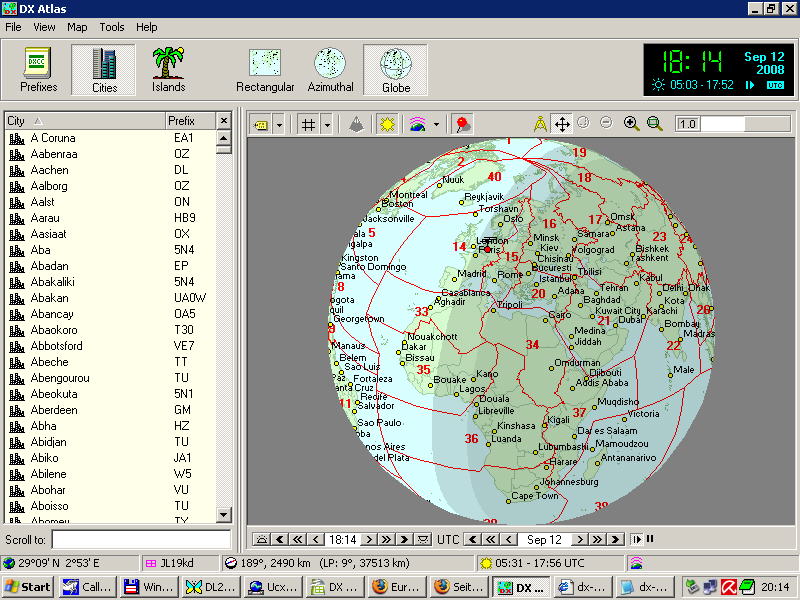
Man kann sich aber auch bei Google Earth eintragen: http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hamweb.html *
Unter http://www.hamatlas.eu/Gg/KML_en.htm * finden sich
"HAM’s treasury files" zur Einbindung in Google Earth. Damit wird Google Earth zum Amateurfunkatlas.
Die schönsten Farben aber hat Global Overlay Mapper * von EI8IC.
Vor der Installation muß .NET installiert weden. (Verzeichnis GOM)
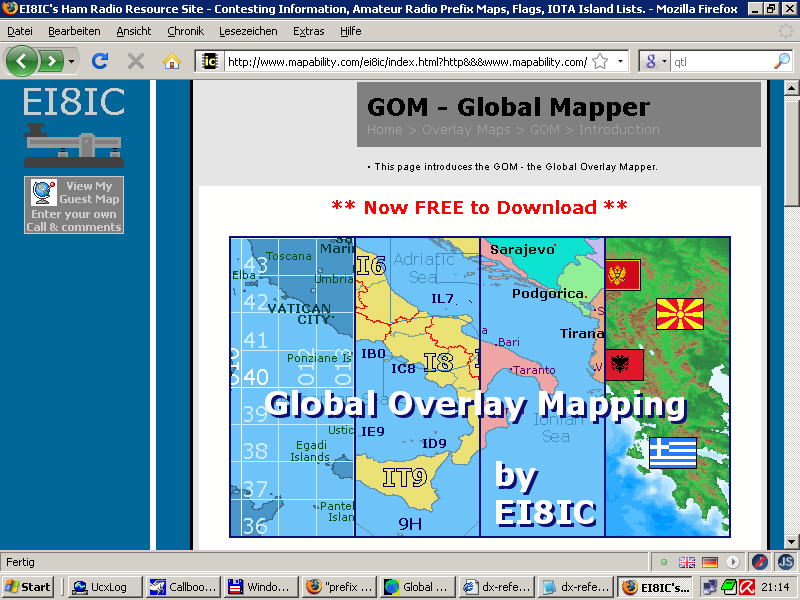
- Ausbreitungsbedingungen
Die Beobachtung der Bakenfrequenzen gibt einen schnellen Überblick der aktuellen
Ausbreitungsbedingungen. Da jede Bake nacheinander mit 3 verschieden Leistungen sendet, weiß man
genau, welche Bänder wohin geöffnet sind und wo man selbst gehört werden sollte.
Als Hilfsmittel zur Bakenbeobachtung bietet sich der Bakenfahrplan des Radio Amateur Callbooks * an. Nach Aufruf des Callbooks klickt man "Extras" und dann "Baken-Fahrplan..." an.
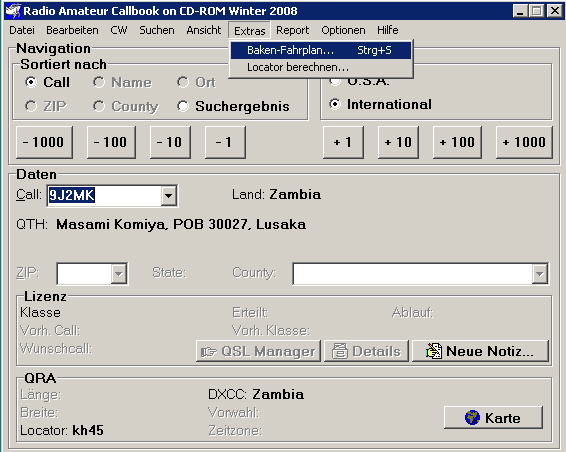
es erscheint der Bakenfahrplan mit der markierten gerade aktiven Bake:
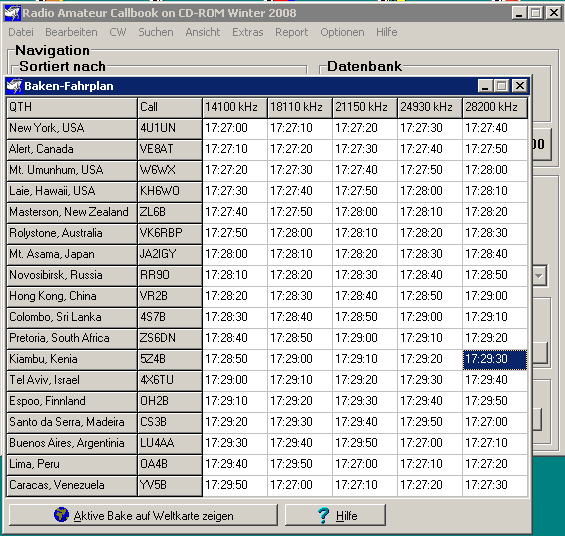
Baken-Fahrplan
nach einem Klick auf "Aktive Bake auf Weltkarte anzeigen" erscheint eine Weltkarte, auf der die gerade aktive Bake angezeigt wird
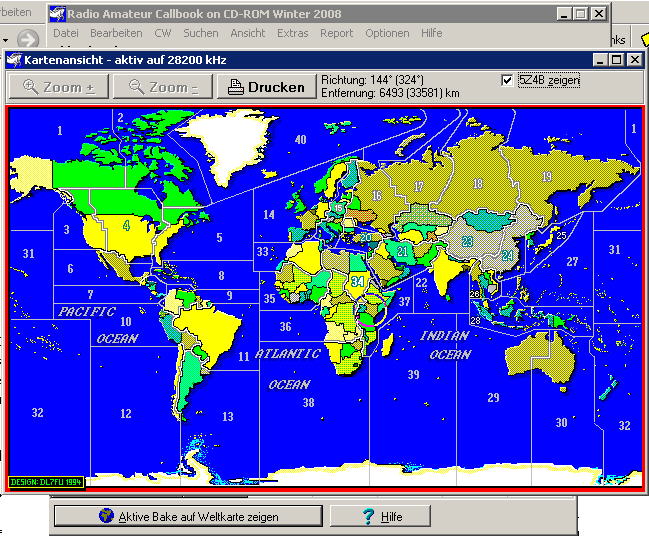
Weltkarte mit aktiver Bake
Tipps: Die CD erhält man umsonst, wenn man dem Callbook neue Rufzeichen-Infos schickt. Die eigenen Infos können auf der Homepage über den Menuepunkt "Updates" geändert werden.
Von Knut Najmann, DJ1ZN * gibt es das Programm beaclock-m-win.exe
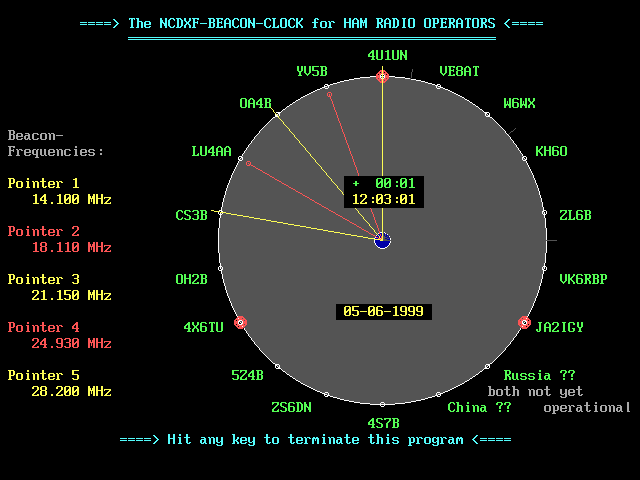
Bildschirmfoto beaclock-m-win.exe (Zeitablauf verkürzt)
Hier gibt es eine
Bauanleitung für eine DCF77-Bakenuhr mit 2-zeiligem LC-Display * von DK1RM
Fertige Uhren gibt es von DJ9PK hier *
Radio Sport Canada bietet eine Zone to Zone Vorhersage * für die Frequenz mit den optimalen Bedingungen für Funkverbindungen zwischen den 40 Zonen mit stündlichen Update an:
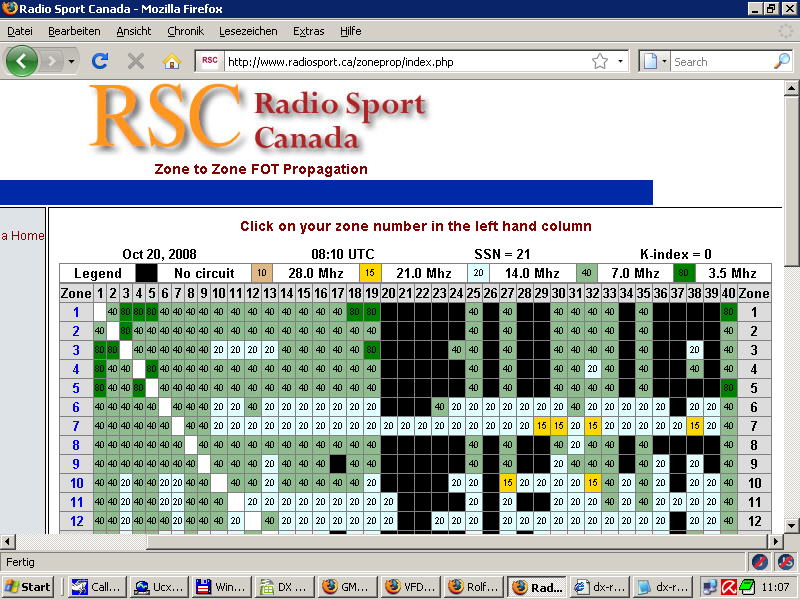
Nach dem Anclicken der Zone 14 erscheint folgendes Bild:
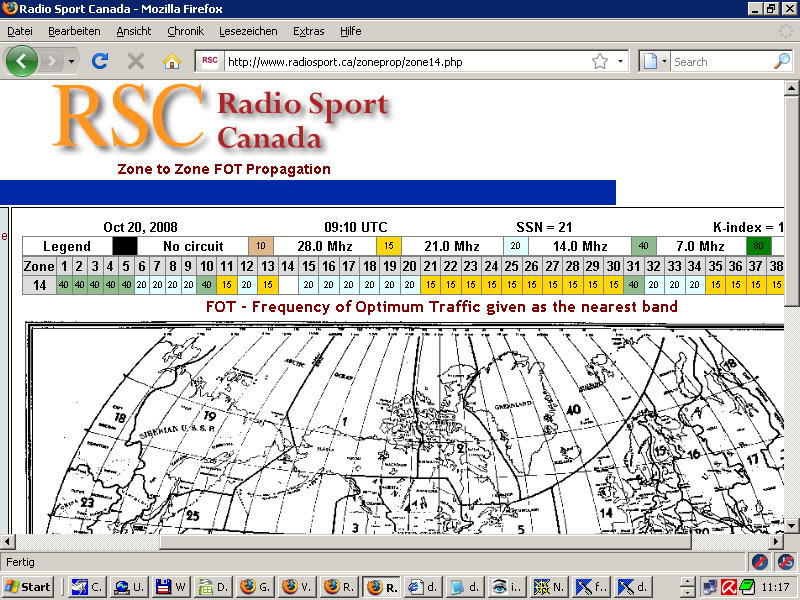
Die Tücken des Kurzwellenfunks: es geht nicht jederzeit alles auf allen Frequenzen. Die Ausbreitungsbedingungen ändern sich mit
Ausreißer von diesen Daumenregeln sind jederzeit möglich. Das macht natürlich auch mit den Reiz des KW-DXens aus. Man muß die Ausbreitungsbedingungen wirklich beobachten. Das macht dann aber auch mehr Freude als eine gespeicherte Nummer mit einem Handy anzurufen oder im Internat per IRC zu chatten.
Darüber hinaus sind die Ausbreitungsbedingungen auch abhängig vom eigenen Standort: Antennenhöhe über Grund, Einflüsse durch
Dabei ist keine Funkstrecke wirklich stabil. Gasatome und Moleküle werden durch extremes Ultraviolett und Röntgenstrahlung der Sonne ionisiert. Intensitätsschwankungen und Störungen des Erdmagnetfeldes beeinflussen die Anzahl und Dichte der freien Elektronen in der Ionosphäre und damit die Fähigkeit, Kurzwellen von der geraden Ausbreitung abzulenken. Infolge von Mehrfachausbreitung muß man immer mit Fading (QSB) rechnen. Die Signalstärke kann dabei von sehr laut bis kaum hörbar schwanken.
Wenn die Kurzwelle tagsüber mal wie ausgeschaltet wirkt, hat der Mögel-Dellinger-Effekt hat zugeschlagen.
Vom DARC-Server stammt DL1VDL's kleines Funkwetterlexikon
Zum gleichen Thema hat Thomas, DG8FBV eine interessante Seite
Begriffserklärungen aus dem Bereich des ´Funkwetters´ und Ausbreitungsvorhersagen für Kurzwelle ins Netz gestellt
Vom ARRL-Server stammt Understanding Solar Indicies
Das cqDL * brachte einen lesenswerten Fortsetzungsartikel
(6/08/414ff, 7/08/481ff, 8/08/565ff, 9/08/639ff und 10/08/720ff)
über den Einfluß der Sonne auf die Funkausbreitung.
Der Rechner sollte über eine genaue Zeit verfügen. Das kann man mit einer
speziellen Funkuhr für den PC erreichen oder über ein kleines
Programm, mit dem der Rechner über das Internet mit
einer Atomuhr synchronisiert werden kann:
Bildschirmfoto TWAtomTime Programmstart
Bildschirmfoto TWAtomTime Verbindung mit Zeitserver
Bildschirmfoto TWAtomTime Synchronisation mit Zeitserver
Bildschirmfoto TWAtomTime Auswahl des Zeitservers
Ab Windows 2000 ist eine Zeitsynchronisierung über das Internet im Betriebssystem enthalten. Dazu in der
Tastleiste die Uhrzeit mit links doppelklicken, Intenetzeit auswählen und jetzt aktualisieren anklicken.
Die exakte PC-Zeit ist ja z. B. auch bei Verwendung eines Logbuchprogramms nötig. Wenn
das QSO nicht sofort (d. h. nur kleine Zeitabweichung von QSL-Angabe und Log) gefunden wird, kommt
sonst im besten Fall die QSL mit dem Vermerk NIL
zurück. Wahrscheinlich aber wandert sie einfach in den Papierkorb als Versuch, für ein nicht
stattgefundenes QSO eine QSL zu ergattern. Mit steigender QSO-Anzahl sinkt wahrscheinlich die
Bereitschaft, ein Log umständlich zu durchsuchen. Bei falsch angebendem Datum hat man
wirklich keine Chance mehr auf die begehrte QSL. Übrigens besteht in Deutschland keine
Logbuch-Pflicht mehr. Es wird von fast allen Funkamateuren aber freiwillig im eigenen Interesse
geführt. Manchmal wird auf das Loggen von Mobil-QSOs verzichtet. UTC berücksichtigt die
Schaltsekunde, GMT nicht. Der Unterschied ist also gering.
Hier möchte ich auch auf die Möglichkeit des Greyline-DXens aufmerksam machen.
Dabei geht es um die ausgezeichneten Ausbreitungsbedingungen entlang der Dämmerungslinie.
Früher gab es mal ein mechanisches DX-Edge mit einem ganzen Satz verschiebbarer Plastikscheiben. Heute gibt es die elektronische Version im Internet:
Greyline-DX mit dem Internet
Die Dämmerungszone trennt das Tageslicht von der Dunkelheit. Die Ausbreitung entlang der Dämmerungszone ist sehr effizient.
Ein wichtiger Grund hierfür ist, daß die D-Schicht, die HF-Signale absorbiert, rasch auf der Sonnenuntergangsseite verschwindet,
und noch nicht auf der Tagesseite aufgebaut werden konnte. Funkamateure und Kurzwellenhörer
haben zu verschiedenen Gebieten der Welt durch die Überwachung dieses Bandes
ausgezeichnete DX-Möglichkeiten, da es sich rund um den Globus bewegt.
Weitergehende Informationen über die Ausbreitungsbedingungen finden sich auf der Webseite
http://dx.qsl.net/propagation/ * (Danke Heinz, DL6GZ für den Link)
Wo wir schon mal bei den Ausbreitungsarten sind, hier noch eine Auflistung:
- das QSO
Funkamateure sind nicht gleichmäßig auf dem Globus verteilt. Manche abgelegenen
Inseln werden vielleicht nur alle paar Jahre mal aktiviert. Amateurfunk ist in manchen
Ländern auch verboten. Albanien und China waren vor Jahren nicht auf den Bändern zu
hören. Zur Zeit warten alle DXer sehnsüchtig auf Nord-Korea. Es gibt "Most-Wanted"-Listen
- je weiter oben ein DXCC-Land steht, um so größer wird der Andrang sein.
DX-Peditionen suchen sich ihr Ziel oft unter Berücksichtigung dieser Liste aus, um
möglichst viele DXer zu einem neuen Land zu verhelfen.
Bei großem Andrang wird häufig "split" gearbeitet: Die DX-Station sendet auf einer
Frequenz und hört auf einer anderen Frequenz. Dabei muß natürlich sichergestellt
sein, daß auch die Split-Frequenz frei ist.
14,195 MHz +_ 5kHz ist nach Empfehlung der IARU Region 1 für DX-Peditionen vorgesehen. Der Effekt ist klar: alle können die
DX-Station störungsfrei hören und so soll für einen möglichst schnellen
Betrieb gesorgt werden. Wer vor dem Rufen nicht lange genug zuhört und auf der Frequenz der
DX-Station ruft, wird dann mit Zwischenrufen wie SPLIT, UP, QSX 5, 5 UP auf seinen Fehler aufmerksam gemacht.
Es kann natürlich auch sein, daß vom vorigen Betrieb noch der Split-Knopf für die Aktivierung des
2. VFO gedrückt ist oder der Clarifier (Rit) eingeschaltet ist. Daher ist es günstig, wenn man die Station immer mit den
gleichen Einstellungen ausschaltet.
Bei einem großen Pile-Up wird aber nicht eine Frequenz sondern ein Frequenzband von 5-10 kHz
genannt. Damit wird der Empfang auch für die DX-Station etwas einfacher. Das Pile-Up wird
entzerrt. Die richtige Taktik hier ist: irgendwo innerhalb der angegebenen Frequenzen rufen -
irgendwann wird die DX-Station "vorbeikommen". Wozu aber ein Frequenzversatz von bis zu 50kHz
gut sein soll, hat sich mir bisher nicht erschlossen. Solche QSOs sollten meiner Meinung nach
als nur Crossband-QSO gewertet werden. Verschiedentlich habe ich auf 20m DX-Stationen beobachtet,
die unterhalb der eigenen Frequenz hören. Das ist ziemlich unverständlich: da auf den
oberen Bändern in USB gesendet wird, muß man
damit rechnen, daß das Pile-Up bis an die eigene QRG herankommt.
Eine andere Art das Pile-Up zu entzerren besteht darin, die Stationen nach der Zahl im
Rufzeichen oder nach Kontinent/Land getrennt aufzurufen.
Häufig wird empfohlen, vor dem eigenen Anruf stur 7 Sekunden zu warten, um das Pile-Up zu knacken.
Manchmal ist die DX-Station aber so schnell, daß man mit dieser Technik nie um Zuge kommt.
Gute Log-Programme bieten nämlich einen DX-Peditions-Modus an, bei dem das nächste Call
bereits vorgeloggt werden kann. Ein möglicher Grund könnten natürlich auch zusätzliche
Empfänger etwa nach folgendem Muster sein:
Die DX-Station muß aber immer sicherstellen, wem der Rapport gilt.
Sonst ist der Frust groß, wenn man nicht weiß, ob man ein gültiges QSO geführt hat!
Angenehm sind auch die DX-Stationen, bei denen man weiß, was sie vorhat.
Manche DX-Station verlangt "2 letters only". Dann dürfen nur die beiden letzten
Buchstaben vom Suffix angegeben werden. Das ist eigentlich illegal. Unser Rufzeichen dient zur
Identifizierung. Das ist mit 2 Buchstaben nicht möglich. Außerdem ist das Verfahren
höchst ineffizient. Wenn die DX-Station 2 Buchstaben aufnehmen kann, kann sie auch das
gesamte Call aufnehmen. So muß der Rest des Calls erfragt werden und es besteht immer noch
die Möglichkeit, daß eine andere Station mit dem gleichen Suffix mit ruft. Andere
DX-Stationen dagegen verlangen "full call". Entweder werden nun die gehörten Stationen einzeln abgearbeitet oder die DX-Station legt
sich eine Liste an und ruft danach auf. Auf jeden Fall ist es wichtig, vor dem eigenen Anruf genau die
Arbeitsweise zu studieren und sich daran zu halten. Das eigene Call darf maximal 2 mal gegeben
werden. 20 Minuten den eigenen Suffix zu brüllen hat mit DXen nichts zu tun. Besser kann man
sich nicht blamieren. Auch wenn MØURX schreibt "Amateur Radio is a full contact sport" - er meint es anders!
Es mag ja letztendlich erfolgreich sein (hoffentlich erhält er einen 00-Rapport) - ich finde es einfach widerlich.
Wirklich lächerlich und ärgerlich wird es, wenn solch ein Brüllaffe (etwas freundlicher: Krokodil mit großer
Klappe und kleinen Ohren) angerufen wird, um endlich Ruhe zu bekommen und der dann nicht
mitbekommt, daß er dran ist. Solche Egoisten und Möchtegern-DXer erhalten von mir eine kurze eMail.
In einem Pile-Up haben Namen, QTH, Stationsbeschreibung usw. nichts zu suchen. Es kostet nur
Zeit und bringt andere Stationen um das QSO - es ist nicht fair und gegen den Ham-Spirit. (In CW wird nur 5nn tu gegeben) Wer
dann noch nach dem Rufzeichen oder dem DXCC fragt, hat sich selbst als unfähig disqualifiziert.
Wenn ich das Rufzeichen nicht gehört habe, kann ich auch kein QSO mit der Station gehabt
haben. Das DXCC kann ich bei auch bei einem Sonder-Prefix selbst herausfinden (Callbook,
Logbuch-Software, Internet, Listen). Ärgerlich auch, wenn eine 10-tägige DX-Pedition
von einer Station 10 mal auf einem Band in der gleichen Modulationsart gearbeitet wird. Solche
Sicherheits-QSOs kann man sich bei Online-Logs auf jeden Fall sparen. Diese Lids haben keine QSL
verdient. Man sollte ihnen wie den Brüllaffen eine Karte "THIS IS NOT A QSL! You are a Lid. No QSO with DK8JB!" schicken.
Ein Dupe-König hat 58(!) QSOs mit einer DX-Station geführt - auf einem Band in SSB.
Ich habe nichts gegen einen täglichen DX-Sked. Aber doch nicht mit einer auf 10 Tage
befristeten DX-Pedition! Wenn wirklich häufig ein zweites QSO notwendig wird, um sicher zu sein,
daß man im Log ist, muß die DX-Station ihre Betriebsabwicklung dahingehend verbessern,
daß man sicher ist, auch geloggt zu sein.
Hier die nicht ganz ernst gemeinten Rules for DXing or How to have more FUN on the Bands.
Ein Mittelding zwischen selbst rufen und jagen stellt die Teilnahme an einem DX-Netz dar.
Man meldet sich bei der Netzkontrollstation an und wird irgendwann aufgerufen, die
gewünschte DX-Station anzurufen. Eine recht langwierige und langweilige Prozedur. Für
weniger geübte OPs speziell auf der DX-Seite ist es eine Möglichkeit, ein
Pile-Up zu verhindern. Wer es mal mit einem Netz versuchen will, hier eine Tabelle von AC6V:
http://www.ac6v.com/nets.htm *
Eine Besonderheit sind Contest-QSOs. (Einen Contest-Kalender findet man auf dem DARC-Server
unter http://www.darc.de/referate/dx/cqdlcont/fgdcc.htm *
Da werden nur beidseitig Rufzeichen, Rapport und Seriennummer (oder je nach Ausschreibung das Alter, der DOK,
Ausgangsleistung, CQ-Zone, das Jahr der Erstlizensierung usw.) ausgetauscht. Kurz und schmerzlos
sozusagen mit ausgezeichneten Möglichkeiten, ein neues DXCC zu arbeiten. Immer wieder
verblüffend ist aber, wenn sich plötzlich zwei Stationen um eine Frequenz streiten.
(I am for 2 hours on this frequency!) Im Eifer des Wettbewerbs wird da wohl vergessen, daß
sich die Ausbreitungsbedingungen ändern können. Stationen, die sich vorher nicht
hören konnten, stören sich plötzlich. Ein anderer Grund kann natürliche auch
eine in eine andere Richtung gedrehte Richtantenne sein. Der Ham-Spirit sollte da eine Lösung
ermöglichen. Vorbildlich in solch einem Fall sind Stationen aus dem Heimatland des Fair-Play.
Achtung: Da heutzutage die eingereichten Logbücher per Software abgeglichen werden, sollte man
nicht nur 1 QSO mit einer interessierenden Station im Contest machen. Als sogenanntes Unique-Call
gibt es Strafpunkte für die andere Station. Die Teilnahme an einem Contest verlangt heute mehrere QSOs!
Häufig werden extra DX-Peditionen anläßlich
eines Funkwettbewerbs organisiert. Es ist ja auch etwas Besonderes, auf der anderen Seite eines Pile-Up
zu sitzen. Dabei verhilft ein Blick in die Ergebnislisten und das Wissen um die eigenen Möglichkeiten
durch Teilnahme in einer geeigneten Klasse ggf. zu einer guten Platzierung. Für diese Expeditionen werden teilweise
unglaubliche Anstrengungen ( BS7H) *
Rockall, EU-189 *
unternommen. Hämische Bemerkungen (z.B. im DX-Cluster:
worst dx-pedition ever; holliday? no ears, last log-upload yesterday) sind unverschämt und
vollkommen unangebracht. Man kann sich die Umstände des Betriebs kaum vorstellen. Eis,
Wirbelstürme, Gewitter, nur stundenweise verfügbarer Strom, Spannungsschwankungen, plötzlicher Stromausfall -
die ganze Palette eben. Auf der Internetseite
http://it.youtube.com/ * kann man unter dem Stichwort "DXpedition" ins Netz gestellte Videos finden.
I2YSB hat auf seiner Internetseite http://www.i2ysb.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 *
unter dem Menupunkt I2YSB Movie DXpeditions Videos seiner DX-Peditionen ins Netz gestellt.
Wem irgend etwas an einer Expedition nicht paßt, dem kann ich nur raten, auf ein QSO und die QSL
zu verzichten, die anderen nicht zu behindern und selbst etwas besseres zu organisieren und viel Geld dafür auszugeben.
1983 wurde die Spratley-Expedition sogar beschossen - es gab Tote. Das
Kurzwellenpanorama von Radio Österreich International
berichtete zum 10. Jahrestag der Katastrophe.
Die VU4RBI / VU4NRO-Expedition hat Weihnachten 2004 z.B. nach der
Tsunami-Katastrophe sofort von Expeditions-Betrieb auf Katastrophenfunk umgestellt. Die
indischen Behörden waren von der Leistungsfähigkeit des Amateurfunks tief beeindruckt. In der Folge wurden sogar Gastlizenzen für VU4 vergeben (militärisches Sperrgebiet).
Wenn DX-Peditionen anläßlich eines Contestes unterwegs sind, kann man sie auch vorher und oft auch
nachher arbeiten - die Station muß ja getestet werden. Allerdings muß man dann mit anderen Calls als im Contest rechnen. (Landeskenner/Heimatcall).
Um sich auf das zu beantragende Rufzeichen LX1A für einen CW-Contest zu einigen,
hat man beim BCC mal einen Abend gebraucht. Das Rufzeichen sollte schnell zu geben sein und gut
verständlich sein. G3SXW schreibt in seinem Buch "Up two - Adventures of a DXpeditioner" *:
I used to spend evenings just sending call-signs on my keyer and listening to the side-tone. The call-sign had to be EP2 plus two letters. I chose EP2IA as beeing the snappiest-sounding at high-speed. ...
Natürlich ist der Andrang zu Beginn einer DX-Pedition groß. Zum Ende hin hört
man die Station oft flehentlich CQ rufen. Dann haben auch kleinere Stationen eine gute Chance auf
ein QSO. Wer auf ein spätes QSO hofft, lebt mit dem Risiko eines vorzeitigen Abbruchs wegen schlechtem Wetter,
Lizenzentzug, Defekten, politischen Unruhen. Das Gegenteil kann natürlich auch eintreten.
Wegen Schlechtwetter ist eine Abholung nicht möglich und so ist die DX-Pedition dann
länger als angekündigt zu arbeiten. DX-Peditionen verfügen heutzutage eine
Webseite. Dort gibt es entweder ein Kontaktformular oder es sind sogenannte Pilot-Stationen
aufgeführt, über die ein Kontakt zur DX-Pedition möglich ist. Ich mache immer
darauf aufmerksam, daß ältere Geräte oft nur weniger als 5 kHz Frequenzversatz
ermöglichen.
Auch wenn man bezüglich der DXCC-Anerkennung einer Station durch die ARRL *
nicht sicher ist gilt die Devise: work first, worry later. Gründe für die
Nichtanerkennung können fehlende oder
unzureichende Lizenzurkunden, Landungsgenehmigungen usw. sein. Dabei herrschen ja nicht überall
verwaltungsmäßig paradiesische Zustände. Wer soll/darf/kann einem UNO-Soldaten
oder einem ICRC- * oder IFRC- *
Mitarbeiter in einem Bürgerkriegsgebiet die Lizenzurkunde ausstellen? Die Lizenz für
ICRC TIM bei meinem Einsatz in Rumänien z.B. hat
der Stadtkommandant von Timişoara handschriftlich auf einem Stück Papier erteilt. Neulich
wurde die Legalität der D9D-DX-Pedition nach Tok Is. (IOTA *
AS-045) von Japanern angezweifelt.
Recht merkwürdig aber auch die DXCC-Anerkennung durch die ARRL. Dafür gibt es zwar
genaue Regeln. Aber was macht es für einen Sinn, ein Riff von der Liste zu
streichen und ein anderes Riff aufzunehmen? Wenn Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen
werden oder sich ehemalige Teilstaaten unabhängig erklären (und von der UN anerkannt werden), ist die Aufnahme als neues
DXCC nötig. Aber ein neues DXCC mit GPS-Daten und der Abstandsregel zu suchen finde ich schon komisch.
Ich könnte gut damit leben, wenn die DXCC-Liste nur alle von der UN anerkannten Staaten
umfassen würde. Was haben ein paar Felsspitzen im südchinesischen Meer auf der
DXCC-Liste zu suchen? Oder irgend eine antarktische Insel, die nur alle 20 Jahre mal aktiviert
wird oder wegen fehlender Erlaubnis einer Fischereibehörde nicht aktiviert werden darf? Wann kommt die DXCC-Anerkennung
von Kosovo? Hat Nord-Cypern jemals eine Chance? Müssen Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint
Eustatius and Bonaire als neue DXCCs anerkannt werden? (Am 12. Februar 2007 wurde eine Vereinbarung
unterzeichnet zwischen den Niederlanden und jede Insel außer Curaçao. Diese Vereinbarung
würde das Ende der Niederländischen Antillen ab 15. Dezember 2008 bedeuten.)
Für alle DXCCs braucht man also nicht nur einen langen Atem sondern auch eine Portion Glück.
Für den einen sind das eher abschreckende und für den anderen eher motivierende Bedingungen.
Bewegen wir uns auf das DXMC (DX Millenium Club) zu? Wie wäre es unter den Umständen
mit einem neuen Diplom WAUN (Worked All United Nations)?
Immer wieder kommt natürlich die Frage nach der weitesten Funkverbindung auf. Mein weitestes QSO habe ich von der Clubstation DLØOM (LØ1) mit Hattingen
geführt. Eine Richtantenne wurde dabei nach Südamerika und die andere nach Japan gedreht. So
kam ein QSO über den langen Weg mit der Nachbarschaft über eine Entfernung von 40.000km
zustande. Der Signalweg war in Folge der Ausbreitung in Sprüngen zwischen Erde und
Ionosphäre natürlich noch um einiges länger. Es gibt Funkamateure, die UKW-Signale
von Raumsonden aufnehmen. Das ist wirklich weit, aber leider kein QSO, hi.
LP-Signale erkennt man an dem typischen Sound (Kathedralen/Echo-Effekt). Im cqDL wurde mal eine
Schirmbildaufnahme eines CW-Punktes gezeigt. 7 Erdumrundungen des schwächer werdenden Signals
waren deutlich auszumachen. Der von DL weitest entfernte Punkt liegt nicht in der Antarktis
sondern südlich von Neuseeland (Antipoden)
DX-Infos
Wer "News" anklickt, findet einen Link zu einer Telnet-Verbindung. Die Anmeldung erfolgt mit
dem eigenen Rufzeichen und "guest" als Passwort. Achtung: die Eingabe von Rufzeichen und Passwort
werden nicht angezeigt! Dafür erscheinen die Cluster-Meldungen sofort.
Das DX-Cluster ist kein Logbuch! Es ist selbstredend auch kein Ort, an dem das eigene
Rufzeichen für die Gegenstation berichtigt wird (14009.3 SM4OTI VK2GDM CALL IS SM4OTI 1150 10-Sep-2008).
Das Cluster ist auch nicht für CQ-Rufe gedacht. Das eigene Call und den Rapport muß
man schon selbst durchbringen. Ansonsten kann man ja gleich QSP-QSOs fahren.
Wenn man ein interessantes DX hört gilt: erst arbeiten, dann ins Cluster einstellen -
sonst kommt man im sich aufbauenden Pile-Up ggf. selbst nicht zum QSO. Aber bitte schön nicht selbst CQ rufen und die DX-Station nach dem QSO mit der eigenen QRG posten in der Hoffnung, andere Stationen (die die DX-Station wollen) anzulocken. Wenn eine DX-Station aber
bereits nacheinander mehrere Mal im Cluster geposted wurde, erübrigt sich eine weitere
Meldung. Was für einen Informationswert hat eine Meldung wie "many tnx for new band"?
Außer den bekannten Betriebs-Abkürzungen, Q-Gruppen, Modulationsbezeichnungen (OLIVIA ist hier kein schöner Name sondern eine Betriebsart! Der Softwareentwickler hat seiner Tochter ein Denkmal gesetzt), IOTA-Referenz-Nummer, US-Staat oder -County (gerne abgekürzt, auch mit vorangestellter Kompaßrichtung, z.B. NCA), Contestnamen usw. kann man im Cluster noch über folgende Infos stolpern:
Manch einer nimmt Anstoß an nicht im Gesetz vorgesehne Rufzeichenzusätze. Dem
kann ich nicht ganz folgen.
Rufzeichenzusätze, die Namen, IP-Adressen, Telefonnummern, Partei- oder Vereinsabkürzungen oder
dergleichen darstellen, sind nicht zulässig.
Sinnvoll wäre vielleicht ein Zusatz
/T (wie Trainee) als Ersatz für die teuren Ausbildungsrufzeichen in der Form DNxabc. In DL
hat jeder Funkamateur das Recht auf Zuteilung eines kostenpflichtigen Ausbildungsrufzeichens und
Nichtlizensierte dürfen unter Aufsicht ohne Ausbildungsrufzeichen Grüße
übermitteln. Da ist der Schritt zu /T doch nicht mehr weit. Wenn das dann noch weltweit einheitlich eingeführt werden könnte...
Hier ist Einsatz der Amateurfunkverbände gefragt.
QSLs
Büro
direkt
via Manager
Noch ein Wort zur eigenen QSL-Karte: Alle QSO-Daten sollen auf der Daten-Seite stehen - auch
das eigene Call. Bei zweiseitigen QSLs sollte zumindest das Call auch auf der Frontseite
stehen (zusätzlich nach Geschmack Name, Anschrift, DXCC, Locator, DOK, Diplome usw.) Das Datum am besten in der
Form TT MMM JJJJ, (z. B. 01 JAN 2008) angeben - das ist weltweit eindeutig.
Hier eine kurze Auswahl der von Managern vorgegebenen Verfahrensweisen, die peinlich genau eingehalten
werden sollten.
GlobalQSL
Hier ein Erfahrungsbericht von DL5XX vom RRDXA (s. a. cqDL 9/08/612)
eQSL
DCL
Der Zugriff auf die Funktionen des DCL ist beschränkt auf autorisierte Benutzer. Das sind
Funkamateure, die in der Vergangenheit ein elektronisches Contestlog für einen der
DARC-Kurzwellenkonteste (WAEDC, WAG, Weihnachtswettbewerb, IARU Reg. 1-Fieldday, 10m-Contest )
eingereicht haben. Wenn Sie noch nicht zu diesen OM's gehören, nehmen Sie doch an einem der o.g.
Contest teil und reichen Sie Ihr Log per E-Mail ein. Einen Testzugang gibt es für das Call DJ9MH
mit dem Passwort 12345. Hier kann man in der Rolle von DJ9MH alle Funktionen ausprobieren.
LoTW
Um die Möglichkeit betrügerischer Einträge in das LoTW zu minimieren, müssen alle QSO-Einträge durch ein von der ARRL erhaltenes digitales Zeugnis unterschrieben werden.
Der Erhalt eines solchen Zeugnisses verlangt einen Echtheitsnachweis der Identität des Lizenzinhabers (USA) oder die Untersuchung der verlangten Dokumentation (Kopie der Amateurfunklizenz und eine Kopie von Ausweis/Reisepaß/Führerschein) durch die ARRL (Nicht-USA).
Diese Kopien müssen per Post geschickt werden an:
Logbook Administration
Von der ARRL entwickelte Software kann zur Umwandlung einer Log-Datei (im ADIF- oder
Cabrillo-Format) in eine digital unterschriebene Datei mit den QSO-Daten umgewandelt werden, die
zum Eintrag ins LoTW vorbereitet wurde
LoTW startete am 15. September 2003 und wird von YAESU gesponsort.
Pop-up-Blocker müssen vor dem Download der Software abgeschaltet werden
Digitale Zeugnisse dürfen bei der Installation einer neuen Software-Version nicht
entfernt werden!
Willkommen beim Logbook of the World (LoTW).
LoTW ist einen neues elektronisches QSO-Bestätigungs-System, welches zur Vereinfachung
und Kostenersparnis bei der Teilnahme an vielen Amateurfunk-Diplom-Programmen entwickelt wurde.
Um LoTW nutzen zu können, muß, man
Mehr ist wirklich nicht zu tun. Denjenigen, die bereits Contest-Logs via eMail eingeschickt
haben, wird die Vorgehensweise bis auf die zusätzliche digitale Unterschrift des Logs
bekannt vorkommen.
Wenn man einmal vom System im LoTW anerkannt wurde, kann man die LoTW-Webseite besuchen und
alle QSOs mit gleichlautenden Eintragungen anderer Stationen sehen.
Die digitalen Zeugnisse gelten jeweils ein Jahr.
Hier eine Powerpoint-Presentation der ARRL von der Internetseite http://www.arrl.org/FandES/ead/materials/videos.html * mit Multimedia-Bücherei.
Diplome
DXCC
DL-DX-Diplom
Und so stellt man sich das DL-DX-Diplom aus:
Der von der Zeitschrift CQ * ausgeschriebene DX-Marathon
steht zwischen Contest und Diplom. Es geht darum, innerhalb eines Jahres möglichst viele DXCCs (338), WAEs (5 zusätzlich) und Zonen
(40) zu arbeiten. Mehr als 383 Punkte sind nicht möglich. Am 1. Januar fängt alles wieder bei 0 an.
Die QSOs werden in einer Tabelle eingetragen.
Clubs
DXen ist also weit mehr als ein QSO mit einer weit entfernten Station.
Es ist einiges an Vorleistung zu erbringen und die Nacharbeit kann einen
auch noch ganz schön beschäftigen.
Der Weg zum Erfolg heißt PEPSI: Patience, Energy, Persistence, Skill, Informaion (Geduld, Energie, Beharrlichkeit, Geschick, Informationen)
Hier noch ein Link zu A, B, C's of Dx: Fundamentals of the Art of DXing * von W5FKX (englisch)
N7NG hat ein Handbuch zu DXpeditioning Basics geschrieben. (englisch)
Von ON4UN und ON4WW stammt das Handbuch Ethics and Operation Procedures for the Radio Amateur (englisch)
ON4WW hat über Betriebstechnik geschrieben, bei dem auch andere Betriebsarten berücksichtigt werden. (deutsch)
Wer CW gerne dem PC überlassen würde, dem kann ich die Software CW-Skimmer * empfehlen. Hier die Skimmer-Internetseite offline.
Vor dem Erlernen von CW sollte unbedingt Die Kunst der Radiotelegrafie von NØHFF zu Rate gezogen werden. (deutsch)
Hier der Link zum Online CW-Lernen: http://www.www.lcwo.net
Internet, PC und Amateurfunk verwachsen immer weiter. Logbücher werden auf dem PC
geführt, Software vereinfacht oder ermöglicht Betriebsarten, Informationen stehen im
Internet bereit und als neue Spielart gibt es EchoLink *:
Die EchoLink-Software erlaubt es lizenzierten Funkamateuren mit anderen Amateur-Station übers Internet zu kommunizieren, unter Verwendung der Voice-over- IP (VoIP) Technologie. Das Programm erlaubt weltweite Verbindungen zwischen Funkstationen, oder zwischen Computer und Funkstationen und erweitert fantastisch die Kommunikationsmöglichkeiten von Amateurfunkstationen. Es gibt mehr als 105'000 registrierte Benutzer in 143 Ländern weltweit!
QSO-Net * funktioniert ähnlich wie Echo-Link, CQ100 ist eine Software um QSOs über das Internet zu
führen, für "Antennengeschädigte" wie auch für alle
Funkamateure, die einfach Interesse an Kommunikation haben, ohne Abhängigkeit von
Ausbreitungsbedingungen, Antennen, Leistung. Statt 59 und QSL via Bureau stehen hier Gespräche im
Vordergrund, in denen es durchaus nicht immer "nur" um Amateurfunkthemen gehen muß.
Hierzu wurde eine graphische Oberfläche ähnlich eines HF Transceivers gewählt wurde .
Es gibt auch einige Verlinkungen zu Relaisstellen oder Simplexlinks, wie es von EchoLink bekannt ist
Noch ein Wort zum DARC * : lizensierte
Nichtmitglieder sind einfach Trittbrettfahrer. Zum Versicherungsschutz bei Teilnahme an
DARC-Veranstaltungen kommt der QSL-Versand, eine anspruchsvolle Clubzeitung und vor allem die
Interessenvertretung (Bundestag, EU-Parlament, Normenausschüsse,
ITU * und
IARU *,
Bandwacht * usw.).
Ohne den wachsamen DARC ging es uns allen schlechter! Der Mitgliedsbeitrag ist wirklich gut
angelegt und wahrlich nicht zu hoch.
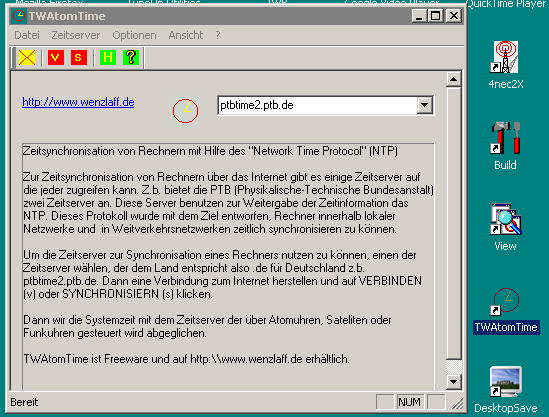
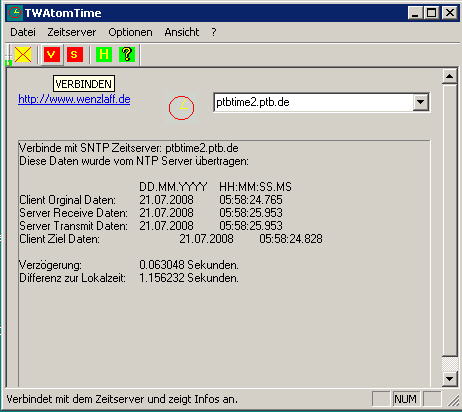

mehrfaches synchronisieren kann die Zeitdifferenz verkleinern
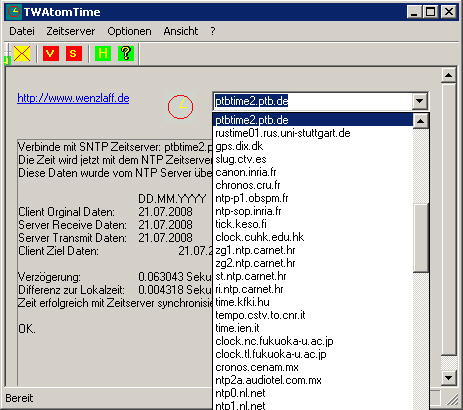
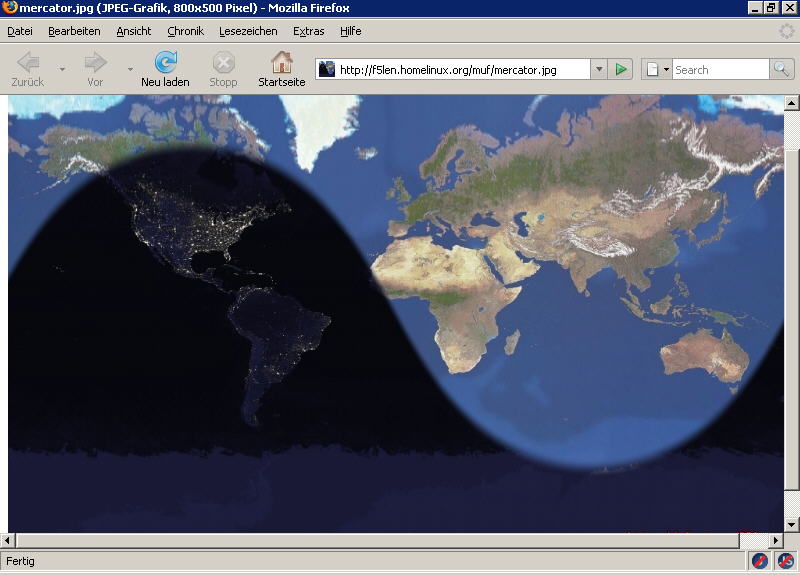
http://f5len.homelinux.org/muf/mercator.jpg *
Eine kurze Übersicht über die Ausbreitungsbedingungen der einzelnen Kurzwellenbänder von DJ1SP
Ausbreitung über die Bodenwelle
eine Streuung vom Ende der Bodenwelle in die tote Zone
eine Streuung vom Auftreffen des ersten Sprungs in die tote Zone
die Ausbreitung über den direkten Weg
die Ausbreitung über den indirekten Weg
der erste Sprung landet im Bereich der (normalerweise) toten Zone
kurzzeitige hohe Ionisation der E-Schicht, die UKW-Überreichweiten ermöglicht
UKW-Verbindungen Erde - Mond - Erde
Hier das ganze Referat HF-DX-Funkwetter auf Kurzwelle
Vor dem QSO muß ggf. der Sender abgestimmt werden. Aber doch bitte nicht auf der
Frequenz der DX-Station! Wenn es unbedingt genau auf der DX-Frequenz sein muß bitte mit Dummyload
.
Es gibt zwei verschiedene Ansätze, um an das gewünschte QSO
zu kommen: man kann selbst "cq dx" rufen und dabei ggf. das Zielgebiet
benennen. (Wer nicht ruft, wird nicht gehört) Dabei muß man sich natürlich an die
Bandpläne halten. Wer über eine
Richtantenne verfügt, muß sich je nach den Ausbreitungsbedingungen
entweder für die Richtung des kurzen Weges (das ist meist der Fall) oder aber die des langen
Weges entscheiden. Eine Beamkarte erleichtert dabei die Richtungseinstellung. Als Jäger dreht man über das Band und versucht,
mit rufenden DX-Stationen ein QSO zu machen.
most wanted DXCC (DARC) *
most wanted DXCC (DX Magazine) *
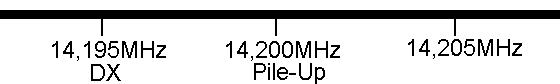
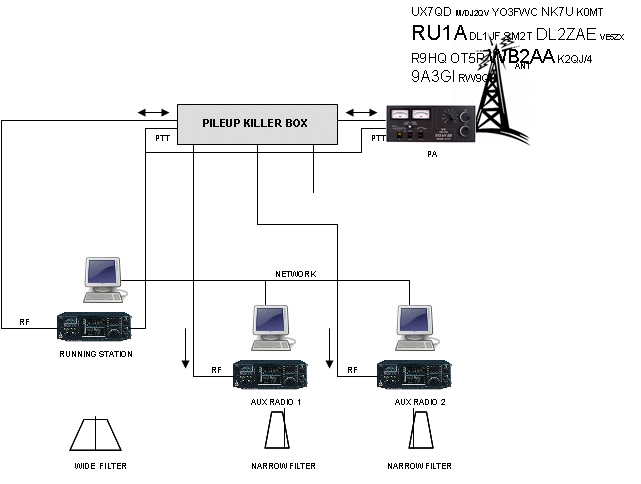
zusätzliche Empfänger
gefunden in einem Aufsatz von N2YO * (englisch) bei UltraDX
NET
NAME
DAY
TIME
UTC
FREQUENCY
NET
CONTROL
10M DX Net
Daily
1430
28.330 MHz
-
247 DX Net
M-F
2100/2400
14.247 MHz
N0JT
14305 DX
Net
Mon - Fri
1300
14.305 MHz
-
Africana Net
Daily
1300 /1800
21.355 MHz
NX5B
ANZA (VK, ZL & Africa)
Daily
0445
21.205 MHz
-
ANZA (VK, ZL & Africa)
Daily
0500
14.183 MHz
-
Arabian Nights Net
Fri
0500
14.250 MHz
JY3ZH
Arkansas DX
Assoc
Sun
0000
3.815 MHz
-
Brazil DX Net
Sat/Sun
18:00/19:00
14.222 MHz
-
Brazil DX Net
Daily
1200/1400
28.430 MHz
-
BRYLA (PY-YLs Net)
Wed
19:00/21:00
14.248 MHz
-
Canada DX Net
Sun
1600
14.173 MHz
-
China DX net
Sat
1300 or
2300
21.410MHz
-
European DX
M,T,W,T,F,S
1500
14.243 MHz
OE6EEG,
4X6DW
Family Hour
Daily
1400-1700
14.245 MHz
-
Family Hour
Daily
1730
21.350 MHz
-
Friendly Caribbean
Daily
1100
14.165 MHz
W2MIG
HI-DX
Daily
0200
14.222 MHz
NI5I
Mexican DX
Daily
0400
3742
XE1PEP
Oceania DX Group
Sat
0330
14.245 MHz
-
Oceania DX Group
Sat
0930
3.620 MHz
-
OKDXA
Sat
2330
3.860 MHz
-
Pacific
Island
Daily
0800
14.315 MHz
V63JC
Pitcarin
Isle
Tues
2330
21.348 MHz
-
Portuguese DX Net
Sat
1000 to 1300
28.480 MHz
-
Portuguese DX Net
Sat
1000 to
1300
21.280 MHz
-
Southern
Cross DX
Daily
1230-1300
14.238.5 MHz
VK6ZAI
& W1FDY
Triple H Net *
Nightly
0700
7.2350 MHz
-
Triple Two (VK9NS)
Sat/Sun
0530
14.222 MHz
-
USA DX
Groupe
Daily
0630
7.240 MHz
W8KLI
YL Pacific
DX
Mon
0600
14.222 MHz
VK9YL
YL Triple Two
Mon
0530
14.222 MHz
-
YL System
Emergency Net
Daily
Sunup to
sunset
14.332 MHZ
DX-Infos gibt es
- in Büchern (eine Auswahl beim DARC-Verlag) *
- in Zeitschriften (z.B.cqDL *, Funkamateur *, CQ *)
- im Deutschlandrundspruch *
- in DX-Mitteilungsblättern (DXMB *, Ohio/Penn DX Bulletin *, 425 DX NEWS *)
- in Callbüchern (z.B. Radio Amateur Callbook *, The QRZ Ham Radio CDROM *)
TBA (to be announced) als QSL-Info heißt einfach, daß die Information noch nicht vorliegt und später bekannt gegeben wird.
- bei QRZ.COM *
- im DX-Cluster (Zugang entweder über Packet Radio oder Internet) DX-Summit *
F5LEN *
SM6.SE *
DX World of Ham Radio * (mit tollen Bildern der Top 50 DXCCs)
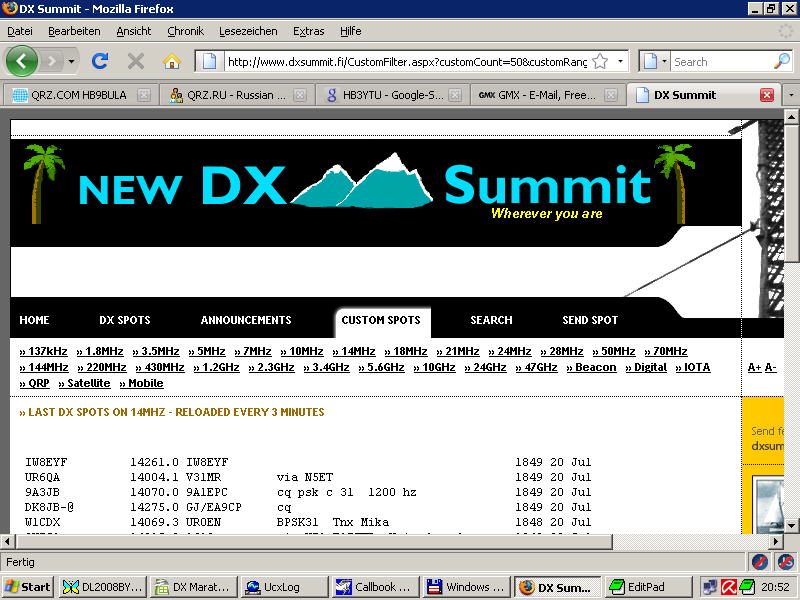
Internetseite DX-Cluster DX-Summit von OH8X
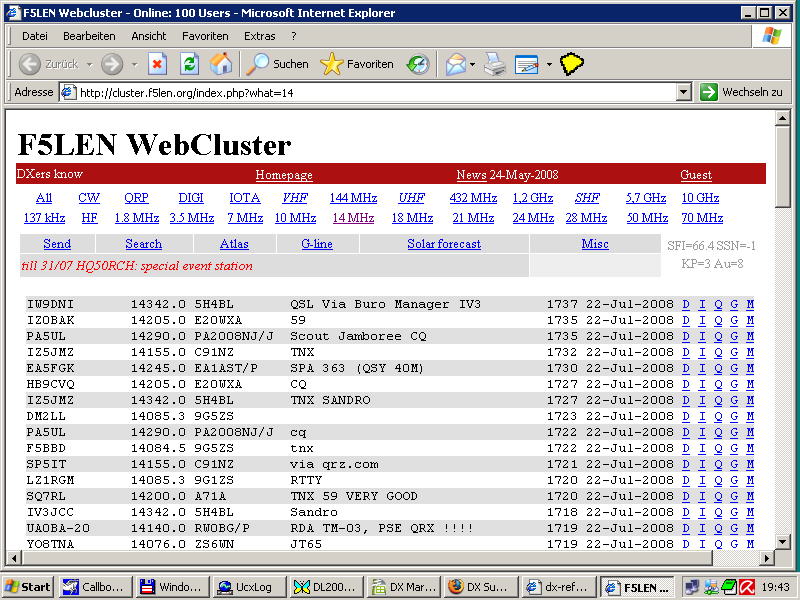
Internetseite F5LEN DX-Cluster
D DXCC-Info mit Karte

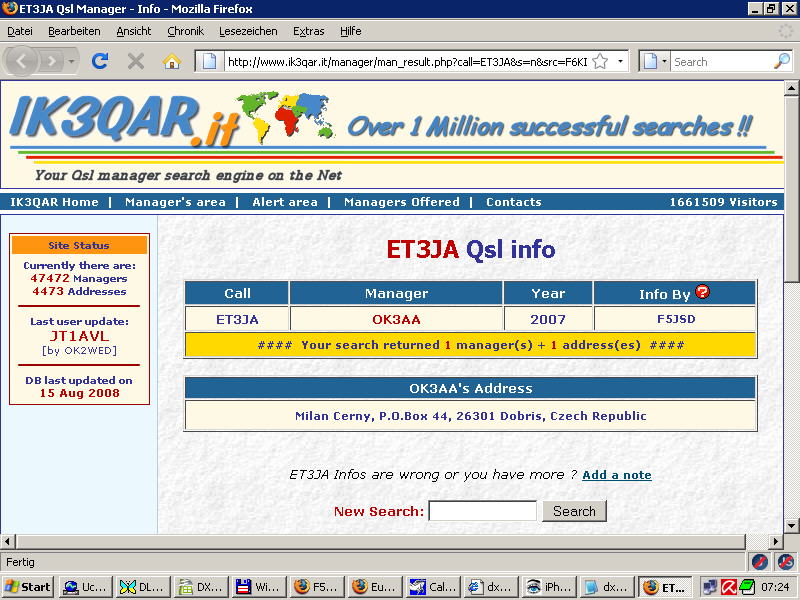
Q QRZ.COM

Die Seite wird demnächst umgestaltet. Hier ein Beispiel *
andere Calls können mit http://www.qrz.com/db/your_callsign aufgerufen werden
G Google
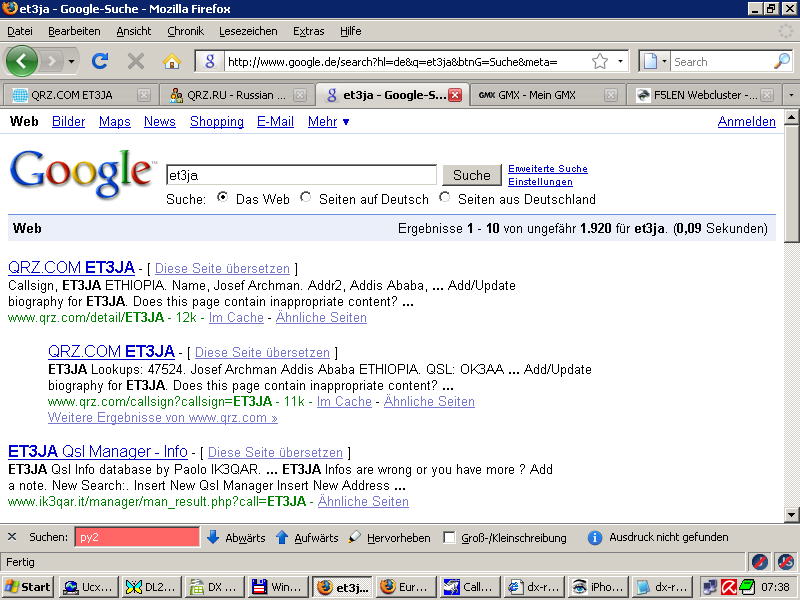
M MUF-Kalkulation
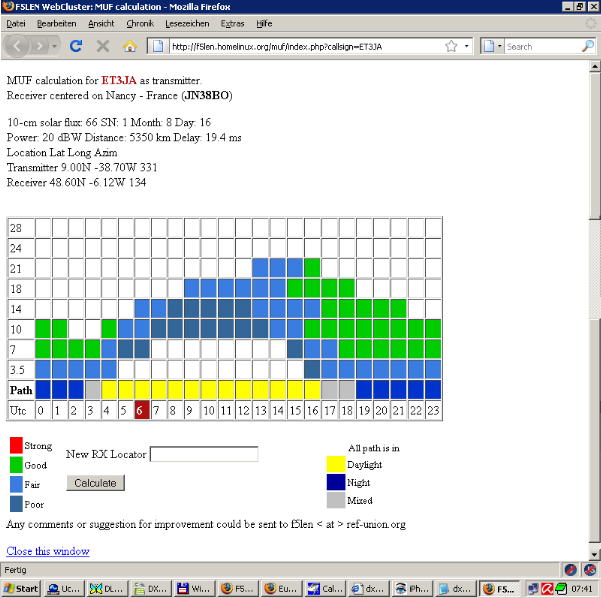

SM6.SE Cluster
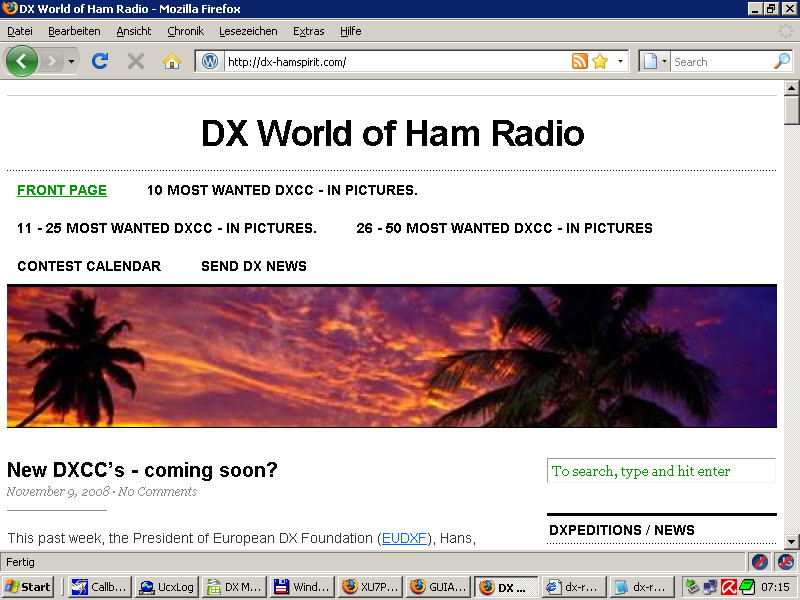
DX World of Ham Radio
/P, /M, /MM und /AM sind eben die amtlich vorgesehen Rufzeichenzusätze für
Portabel-, Mobil-, Maritim-Mobil- und Aeronautik-Mobil-Stationen (die im Übrigen nicht
einmal benutzt werden müssen!). Wo steht denn im Amaterufunkgesetz, daß nicht auch
andere Zusätze erlaubt sind? Das Rufzeichen wird durch einen Zusatz weder verfälscht
noch gefälscht. Ein Rufzeichenzusatz sollte einfach als Information im QSO angesehen
werden. Die eindeutige Identifizierung bleibt erhalten. Mit dem vorauseilenden Gehorsam wollen
wir es doch nicht übertreiben. Übrigens wissen die Funkamateure am besten, was für
die Abwicklung ihres Funkdienstes zweckdienlich ist. Meine Meinung sehe ich gestützt durch die Verfügung Nr. 13 / 2005 der Bundesnetzagentur. Unter der Überschrift „Gebräuchliche Rufzeichenzusätze“ heiß es:
- Büro *
- direkt
- via Manager
- GlobalQSL *
- eQSL *
- DCL * (DARC Contest Logbuch)
- LoTW * Logbook of the World der ARRL *
- OQRS Online QSL Request System (Büro-QSL kann online abgerufen werden werden)
Der übliche Weg ist, die QSL-Karten ausgefüllt (Achtung: rot wird z.B. in UA als Beleidigung empfunden) zum OV-Abend
mitzubringen und in die Ausgangsfächer einsortieren. Der QSL-Manager
wird die Karten monatlich zum QSL-Büro des
DARC nach Baunatal schicken. Dort werden die Karten entweder an die Ortsverbände
innerhalb Deutschlands verteilt oder an die anderen QSL-Büros in der
Welt verschickt. Die eingehenden Karten nehmen den umgekehrten Weg. Mit
dem Mitgliedsbeitrag wird unter anderem dieser Service ermöglicht.
Dazu steht in der DARC-Zentrale in Baunatal eine leistungsfähige
Sortiermaschine zur Verfügung. Das QSL-Büro in Baunatal gehört weltweit zu den besten. Der
DARC hat die QSL-Vermittlung in einem QSL-Manager Merkblatt beschrieben.
Wer QSL-Karten über das Büro verschickt, sollte dem Manager und der Vermittlung die Arbeit
so einfach wie möglich machen und alle Hinweise beherzigen. Berichtigungen haben auf einer QSL-Karte nichts zu suchen.
In solch einem Fall ist eine neue QSL-Karte auszufüllen. Bei der Vorlage für ein Diplom
würde die berichtigte QSL-Karte nämlich ggf. als Betrugsversuch eingestuft. Das
wollen wir dem QSO-Partner doch ersparen.
Manchmal wird eine QSL-Karte direkt verlangt. Der QSO-Partner ist dann entweder nicht
Mitglied in einem nationalen Amateur Radio Club oder es gibt in seinem Land gar keinen Club.
Um dann nach einem QSO an die gewünschte QSL-Karte zu kommen, schickt man seine QSL per Post
an den QSO-Partner. Im Briefumschlag stecken dann die eigene QSL, ein SAE
und ein IRC *
(International Reply Coupon, Internationaler Antwortschein, in DL nur noch über das
Internet bestellbar). Internationale Antwortscheine werden zur Bezahlung des Beförderungsentgelts von Vorrang-Standardbriefsendungen ins Ausland (u.a. Postkarten oder Standardbriefen inkl. Luftbeförderung) verwendet.
Man unterscheidet zwischen dem Verkauf von Internationalen Antwortscheinen ausschließlich über die eFiliale und der Einlösung von Internationalen Antwortscheinen in den Filialen der Deutschen Post.
Der Verkaufspreis für einen Internationalen Antwortschein beträgt: 2,00 EUR oder bis
zu 3 US-Dollar. Der US-Dollar wird unter den Funkamateuren der Farbe und Funktion nach auch
Greenstamp (grüne Briefmarke) genannt. So wird das QSO dann richtig teuer.
Der Brief sollte in jedem Falle unauffällig sein, kein Rufzeichen in der Adresse oder im
Absender enthalten und eine leicht beschädigte Briefmarke führt keinen Sammler auf dem
Postweg in Versuchung. Es schadet aber nichts, ein paar abgestempelte Briefmarken (von erhaltenen Direkt-QSLs oder kg-Beutel) beizulegen.
Häufig sammelt der Manager Briefmarken und kann so für seine Tätigkeit etwas
belohnt werden. Auf beide Umschläge gehören auf jeden Fall
Absender und Empfänger. So besteht die Chance, daß der Brief bei Unzustellbarkeit
zumindest zurück kommt. Man ist informiert und der Dollar ist gerettet. Der Rückumschlag muß gefaltet werden. Der Umschlag sollte
mit der Falz nach unten eingelegt werden. So wird er vom Manager nicht aufgeschlitzt.
Auf die innere Seite der Klappe des SAE sollte man das eigene Rufzeichen schreiben.
Das erleichtert dem Manager ggf. die Arbeit. Bei Sendungen in die Tropen kann ein eingelegtes
Wachspapier (Metzgerwachspapier, Sahneabdeckpapier vom Bäcker, Einschlagpapier vom
Käsemann) das Verkleben des Rückumschlags durch Feuchtigkeit verhindern.
Briefe sollten nicht als Einschreiben geschickt und dadurch als potentiell wertvoll markiert
werden. Ich verstehe aber nicht ganz, wie man viel Geld für eine DX-Pedition ausgeben kann und
dann versucht die QSL-Kosten zu senken. Das ist in etwas so, als wenn ich in gefährdete
Gebiete fahre und aus Kostengründen auf Schutzimpfungen und Prophylaxe verzichte. Dem DX-Peditionär
sollte die Freude des Pile-Up auch die QSLs wert sein.
Aus den unterschiedlichsten Gründen wird oft ein Manager eingeschaltet, der die QSLs
vermittelt. Entweder ist der Funkamateur nicht Mitglied in einem Club, oder es gibt im Land
keinen Club oder es ist ein Funkamateur auf DX-Pedition. Wenn der Amerikaner W9OP beispielsweise
als V25OP aus Antigua QRV ist, kommt eine Karte über das V2-Büro mit Sicherheit nicht
an. Die Karte kommt allenfalls mit einem Vermerk wie z.B "unknown" oder "not member" zurück und
hat so das System zweimal unnütz belastet. In diesem speziellen Fall ist W9OP der Manager für seine eigenen Funkaktivitäten von Antigua aus.
Aber das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, den Manager zu kennen. Wer Manager ist, erfährt
man im QSO oder aus oben genannten DX-Infos. Je nach Manager kann man seine QSL über das Büro schicken oder direkt.
Der Manager trägt die anfallenden Kosten oft aus eigener Tasche und verwendet einen
großen Teil seiner Freizeit dazu, den Funkamateuren zu einer QSL zu verhelfen. Wir sollten
ihnen allen sehr dankbar sein und ihm seine Arbeit so einfach wie möglich machen!
Die QSL-Manager von großen DX-Peditionen oder von sehr aktiven OMs freuen sich aber
auch über selbstklebende Briefumschläge. Das spart bei 10.000 oder auch 100.000 Briefen doch einiges an Zeit.
Da hatte jemand die geniale Idee, Log-Daten elektronisch an die Druckerei schicken zu lassen
Der QSL-Druck erfolgt dann gleich mit den QSO-Daten.

Startseite von GlobalQSL
Um Kosten zu sparen, hat man sich die eQSL ausgedacht. Die QSO-Daten werden im Internet in
eine Datenbank hochgeladen und die QSL-Karten automatisch erstellt und bei
eQSL * zur Verfügung gestellt.
Dazu muß man sich auf der Seite registrieren. Die elektronischen Standard-QSLs sind nicht
besonders schön. Wer seine eigene QSL elektronisch versenden will, muß zahlen. Der
Nachteil der ganzen Geschichte: eQSLs werden noch kaum für irgendwelche Diplome anerkannt.

Startseite
Was bietet DCL?
• Diplome beantragen ohne QSL-Karten heraussuchen
• Diplome beantragen ohne Listen schreiben
• System enthält QSO-Daten vieler DARC-Conteste seit 1998 ,WAG ab 2000
• WAE ab 1998 (CW, SSB, RTTY ab 2001), Weihnachtscontest ab 2000, 10m-Contest ab 2004
• Fieldday (CW, SSB) ab 2005
• ein kontrolliertes QSO entspricht formal einer QSL (=QSO-Bestätigung),
• dazu müssen beide Logs vorliegen und das QSO vorhanden sein
• WAE-Diplom, Europa-Diplom, EUDX-Diplom können beantragt werden
• Ausprobieren: DJ9MH Passwort: 12345
ARRL's Logbook of the World (LoTW) System ist ein Verwahrort von Logbuch-Eintragungen von Anwendern aus der ganzen Welt. Falls beide Teilnehmer eines QSOs gleichlautende Einträge im LoTW vornehmen ist das Ergebnis eine QSL, die für ARRL-Diplome anerkannt wird.
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
(1) die LoTW-Software runterladen
(2) ein digitales Zeugnis von der ARRL beantragen
(3) dieses Zeugnis zur Unterschrift der ADIF- oder Cabrillo-Datei benutzen
(4) diese so unterschriebenen Dateien via eMail oder über die Webseite hochladen und
(5) eine Bestätigung von KoTW über den Erhalt der Log-Daten erhalten.
- DXCC * DX Century Club (ARRL)
- DL-DX-Diplom * (DARC)
- WAC * Worked All Continents (IARU)
- WAS * Worked all States (ARRL)
- WAZ * Worked All Zones (CQ)
Das klassische DX-Diplom. QSL-Karten müssen zur Prüfung eingereicht werden. Das geht
entweder direkt bei der ARRL, bei einem Prüfer in DL oder auf der HamRadio * in Friedrichshafen am ARRL-Stand.
Zu den Kosten für das Grunddiplom kommen die Kosten für Erweiterungssticker und
Band- und Mode-Versionen des Grunddiploms.
Diese Diplom kann online beantragt werden. QSL-Karten müssen vorliegen, werden aber
nicht geprüft. Es wird an den Ham-Spirit appelliert. Wer sich dann ein Full-House auf allen
Bändern ausstellt, wird wohl auffallen, denn alle Diplominhaber werden mit ihren
Länderständen im Internet veröffentlicht. Der Blick in den Spiegel wird ggf. auch
zur Qual.
http://www.darc.de/referate/dx/fgdxl.htm *
im linken Fenster Meldung (auch SWL)
falls nicht über call@darc.de erreichbar, muß bei Peter Hoffmann, dk2ng@dxhf.darc.de eine PIN angefordert werden
Bandpunkte können im Schritt 4 eingetragen werden.
das Diplom gibt es dann unter Ergebnisse der Sendeamateure als PDF-Datei.
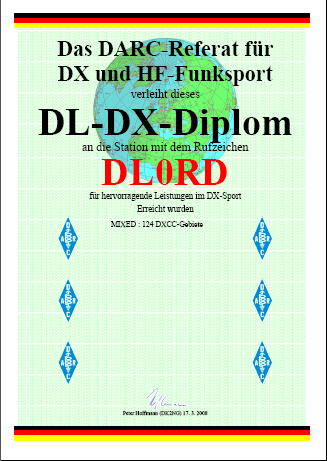
DL-DX-Diplom für DLØRD
Rhein Ruhr DX Association * (RRDXA)
Bavarian Contest Club * (BCC)
German DX Foundation * (GDXF)
European DX Foundation * EUDXF
Süddeutsche DX-Gruppe * (SDDXG)
Northern California DX Foundation * (NCDXF)
Clipperton DX Club * CDXC
Swiss DX Foundation * SDXF
Diplom Interessen Gruppe * DIG